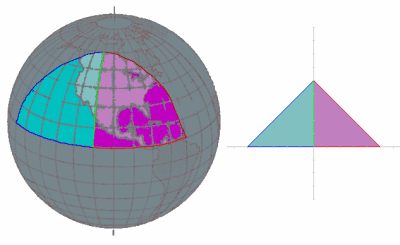noch mal die mathematik
> Date: Tue, 02 Mar 2010 13:55:03 +01
>
> Liebe Kantianer,
>
> im Anhang hat sich Jochen um die Philosophie und unseren
> Kurs verdient gemacht, indem er gezeigt hat, wie man in der
> Mathematik den Satz "7 + 5 = 12" "beweist", d.h. auf einige
> wenige Grundsätze (Peano-Axiome) zurückführt.
>
> Das betrifft ein Thema in den Prolegomena, zu dem wir bald
> kommen werden: nämlich die Frage, ob Mathematik "analytisch"
> oder "synthetisch" ist.
>
> Keineswegs muß jedem Jochens fachchinesische Darstellung schon
> sofort einleuchten. Es lohnt sich aber, sich einmal mit diesem
> Denken und Darstellen zu beschäftigen. Hier ist nun Gelegenheit
> dazu, und ich meine, das Risiko einer Veröffentlichung für
> alle Kursteilnehmer eingehen zu können, da Jochen im Kurs
> alle Fragen klar und bereitwillig
Bereitwillig - gerne.
Klar - so gut ich es kann.
> beantworten wird. Um das zu
> erleichtern, wäre es schön, wenn jeder sich die paar Seiten
> ausdrucken und mitbringen könnte.
>
> Nur eines wird Jochen nicht erklären können: Die 5 Axiome
> (Grundsätze) von Peano selber . Oder sind die etwa in sich
> selber einsichtig?
Mathematiker erklären (heutzutage) keine Axiome (mehr).
Ich glaube, diese Einstellung stammt von Hilbert (um 1900):
man betrachtet eine mathematische Theorie (wie z.B. Arithmetik, Geometrie)
als formales Spiel, dessen Regeln die Axiome sind.
Nach deren "Sinn" oder "Gültigkeit" fragt man dann ebensowenig wie
z.B. beim Schach.
Die Frage, ob die Axiome irgendetwas aus der Wirklichkeit beschreiben,
überläßt ein Mathematiker anderen, nämlich denen, die seine Theorie
anwenden wollen.
Im Fall der Geometrie wird das vielleicht deutlich:
wenn ein Ingenieur Geometrie braucht, um die Grundfläche eines Hauses zu
bestimmen, kann er die euklidische Geometrie der Ebene verwenden.
Wenn er aber die Grundfläche von Afrika bestimmen will, ist letztere
nicht mehr adäquat, da dann die Kugelgestalt der Erde ins Gewicht
fällt.
Beim Haus "gelten" Euklids Axiome (jedenfalls noch mit "ausreichender
Genauigkeit"), bei Afrika nicht mehr.
Wenn der Ingenieur aber auch für Afrika mit Euklids ebener Geometrie
arbeitet - also "das falsche Spiel spielt" - und seine Ergebnisse
nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben, ist das dem
Mathematiker egal.
> Schon seit der Altsteinzeit vermutlich hat man "verstanden"
> ("gesehen"), daß 5 + 7 = 12. Vor 100 Jahren erst hat man
> das bewiesen.
>
> Wenn man "verstehen" will, nützt Ableitbarkeit aus Axiomen
> gar nichts, wenn die Axiome selbst nicht evident sind.
Das stimmt.
Aber ich wollte auch gar nicht verstehbar machen, daß oder warum "5 +
7 = 12" gilt.
Ich wollte vor allem argumentieren, daß die Berechnung "5 + 7 =
12" nach heutigem Verständnis rein analytisch ist: sie folgt
als Tautologie aus den Peano-Axiomen ("Definition des Begriffs
der natürlichen Zahlen") und den Definitionen von "5",
"7", "12" und "+".
Ganz so, wie aus der Definition "Gold ist ein gelbes Metall" der Satz
"Gold ist gelb" folgt.
Nur eben ordentlich viel komplizierter; nur das isst der Grund, wieso
Mathematiker überhaupt dafür bezahlt werden, daß sie am laufenden Band
Tautologien ("bewiesene Sätze" sagen sie dazu) produzieren.
> Nichts anderes meint Kant, wenn er davon redet, daß mathe und
> Geometrie "synthetisch" sind. Er sagt nur, daß am Grunde oder
> Anfang der Mathematik etwas stehen muß, daß in sich selbst
> verständlich ist.
Das hatte auch so ungefähr auch mal gedacht, aber ich bin irritiert
worden durch den Satz in §2 der Prolegomena:
Will man mir aber dieses nicht
einräumen, wohlan, so schränke ich meinen Satz auf die reine
Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bringt,
daß sie nicht empirische, sondern bloß reine Erkenntnis a
priori enthalte.
Der sieht so aus, als hätte auch kant schon "reine" und "angewandte"
Mathematik unterschieden.
Meint "reine Mathematik" bei Kant nicht das gleiche wie später bei
Hilbert (s.o., eben eine Art "Spiel" nach willkürlichen Regeln)?
Was aber dann stattdessen?
>
> Darauf kann man natürlich auch verzichten (tut man heute auch)
> - muß man aber nicht.
>
> Z.B. Paul Lorenzen in der jüngeren Vergangenheit und seine
> Schule verzichten darauf nicht. Sie streben eine "Evidenz" an,
> die sich ergibt, wenn man eine Konstruktionsvorschrift immer
> wieder anwendet (zB. einen Strich I ziehen, dann noch einen
> Strich II, dann noch einen III etc; sehr verkürzt). - (Für
> Jochen speziell: Darüber steht auch bei Hans Hermes etwas.`):
Bei mir steht leider nicht viel:
37, I.6.2: "Junktoren"
56, II.2.2: "Inversion" (= Konstruktion des Ableitungsbaums eins Terms)
196, A: Lehrbuch 1967
197, F: Buch 1955 Nicht-Klass. Logik --> vermutlich meinst Du das
> Verstehen durch Selbermachen. Lorenzen "Man versteht nur,
> was man selber macht"
Läuft das nicht darauf hinaus, daß man die Peano-Axiome letztlich doch
(vielleicht als "unmittelbar evident") voraussetzt?
Dann ist es mir lieber zu sagen, ich setze sie ausdrücklich voraus.
Damit ist "unmittelbare Evidenz" (wenn er es denn so nennt) klar
getrennt von Tautologie.
Das erste ("Warum gelten die Peano-Axiome?") ist eine philosophische,
das zweite ("Wenn sie gelten, warum ist dann 5+7=12?") eine
mathematische Frage.
Die erste wird vermutlich eine synthetische Erkenntnis sein, die
zweite ist m.E. eine analytische, sogar eine tautologische
(das wollte mein Pamphlet demonstrieren).
>
> Gruß
>
> Christian Hermann
>
>
> Liebe Kantianer,
>
> im Anhang hat sich Jochen um die Philosophie und unseren
> Kurs verdient gemacht, indem er gezeigt hat, wie man in der
> Mathematik den Satz "7 + 5 = 12" "beweist", d.h. auf einige
> wenige Grundsätze (Peano-Axiome) zurückführt.
>
> Das betrifft ein Thema in den Prolegomena, zu dem wir bald
> kommen werden: nämlich die Frage, ob Mathematik "analytisch"
> oder "synthetisch" ist.
>
> Keineswegs muß jedem Jochens fachchinesische Darstellung schon
> sofort einleuchten. Es lohnt sich aber, sich einmal mit diesem
> Denken und Darstellen zu beschäftigen. Hier ist nun Gelegenheit
> dazu, und ich meine, das Risiko einer Veröffentlichung für
> alle Kursteilnehmer eingehen zu können, da Jochen im Kurs
> alle Fragen klar und bereitwillig
Bereitwillig - gerne.
Klar - so gut ich es kann.
> beantworten wird. Um das zu
> erleichtern, wäre es schön, wenn jeder sich die paar Seiten
> ausdrucken und mitbringen könnte.
>
> Nur eines wird Jochen nicht erklären können: Die 5 Axiome
> (Grundsätze) von Peano selber . Oder sind die etwa in sich
> selber einsichtig?
Mathematiker erklären (heutzutage) keine Axiome (mehr).
Ich glaube, diese Einstellung stammt von Hilbert (um 1900):
man betrachtet eine mathematische Theorie (wie z.B. Arithmetik, Geometrie)
als formales Spiel, dessen Regeln die Axiome sind.
Nach deren "Sinn" oder "Gültigkeit" fragt man dann ebensowenig wie
z.B. beim Schach.
Die Frage, ob die Axiome irgendetwas aus der Wirklichkeit beschreiben,
überläßt ein Mathematiker anderen, nämlich denen, die seine Theorie
anwenden wollen.
Im Fall der Geometrie wird das vielleicht deutlich:
wenn ein Ingenieur Geometrie braucht, um die Grundfläche eines Hauses zu
bestimmen, kann er die euklidische Geometrie der Ebene verwenden.
Wenn er aber die Grundfläche von Afrika bestimmen will, ist letztere
nicht mehr adäquat, da dann die Kugelgestalt der Erde ins Gewicht
fällt.
Beim Haus "gelten" Euklids Axiome (jedenfalls noch mit "ausreichender
Genauigkeit"), bei Afrika nicht mehr.
Wenn der Ingenieur aber auch für Afrika mit Euklids ebener Geometrie
arbeitet - also "das falsche Spiel spielt" - und seine Ergebnisse
nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben, ist das dem
Mathematiker egal.
> Schon seit der Altsteinzeit vermutlich hat man "verstanden"
> ("gesehen"), daß 5 + 7 = 12. Vor 100 Jahren erst hat man
> das bewiesen.
>
> Wenn man "verstehen" will, nützt Ableitbarkeit aus Axiomen
> gar nichts, wenn die Axiome selbst nicht evident sind.
Das stimmt.
Aber ich wollte auch gar nicht verstehbar machen, daß oder warum "5 +
7 = 12" gilt.
Ich wollte vor allem argumentieren, daß die Berechnung "5 + 7 =
12" nach heutigem Verständnis rein analytisch ist: sie folgt
als Tautologie aus den Peano-Axiomen ("Definition des Begriffs
der natürlichen Zahlen") und den Definitionen von "5",
"7", "12" und "+".
Ganz so, wie aus der Definition "Gold ist ein gelbes Metall" der Satz
"Gold ist gelb" folgt.
Nur eben ordentlich viel komplizierter; nur das isst der Grund, wieso
Mathematiker überhaupt dafür bezahlt werden, daß sie am laufenden Band
Tautologien ("bewiesene Sätze" sagen sie dazu) produzieren.
> Nichts anderes meint Kant, wenn er davon redet, daß mathe und
> Geometrie "synthetisch" sind. Er sagt nur, daß am Grunde oder
> Anfang der Mathematik etwas stehen muß, daß in sich selbst
> verständlich ist.
Das hatte auch so ungefähr auch mal gedacht, aber ich bin irritiert
worden durch den Satz in §2 der Prolegomena:
Will man mir aber dieses nicht
einräumen, wohlan, so schränke ich meinen Satz auf die reine
Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bringt,
daß sie nicht empirische, sondern bloß reine Erkenntnis a
priori enthalte.
Der sieht so aus, als hätte auch kant schon "reine" und "angewandte"
Mathematik unterschieden.
Meint "reine Mathematik" bei Kant nicht das gleiche wie später bei
Hilbert (s.o., eben eine Art "Spiel" nach willkürlichen Regeln)?
Was aber dann stattdessen?
>
> Darauf kann man natürlich auch verzichten (tut man heute auch)
> - muß man aber nicht.
>
> Z.B. Paul Lorenzen in der jüngeren Vergangenheit und seine
> Schule verzichten darauf nicht. Sie streben eine "Evidenz" an,
> die sich ergibt, wenn man eine Konstruktionsvorschrift immer
> wieder anwendet (zB. einen Strich I ziehen, dann noch einen
> Strich II, dann noch einen III etc; sehr verkürzt). - (Für
> Jochen speziell: Darüber steht auch bei Hans Hermes etwas.`):
Bei mir steht leider nicht viel:
37, I.6.2: "Junktoren"
56, II.2.2: "Inversion" (= Konstruktion des Ableitungsbaums eins Terms)
196, A: Lehrbuch 1967
197, F: Buch 1955 Nicht-Klass. Logik --> vermutlich meinst Du das
> Verstehen durch Selbermachen. Lorenzen "Man versteht nur,
> was man selber macht"
Läuft das nicht darauf hinaus, daß man die Peano-Axiome letztlich doch
(vielleicht als "unmittelbar evident") voraussetzt?
Dann ist es mir lieber zu sagen, ich setze sie ausdrücklich voraus.
Damit ist "unmittelbare Evidenz" (wenn er es denn so nennt) klar
getrennt von Tautologie.
Das erste ("Warum gelten die Peano-Axiome?") ist eine philosophische,
das zweite ("Wenn sie gelten, warum ist dann 5+7=12?") eine
mathematische Frage.
Die erste wird vermutlich eine synthetische Erkenntnis sein, die
zweite ist m.E. eine analytische, sogar eine tautologische
(das wollte mein Pamphlet demonstrieren).
>
> Gruß
>
> Christian Hermann
>
neuruppino - 9. Mär, 16:06


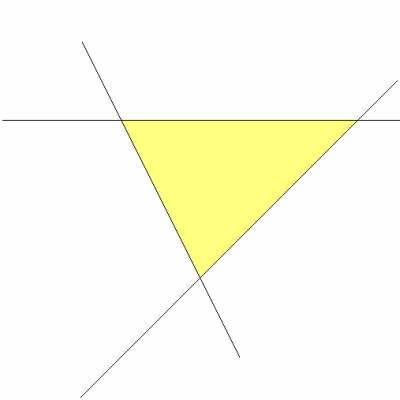
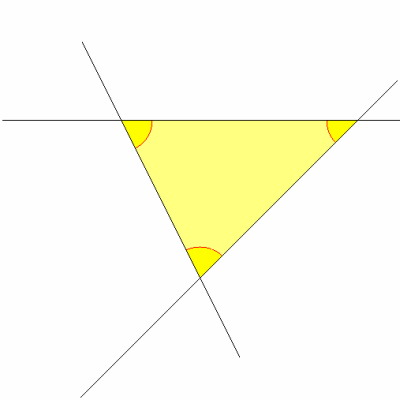
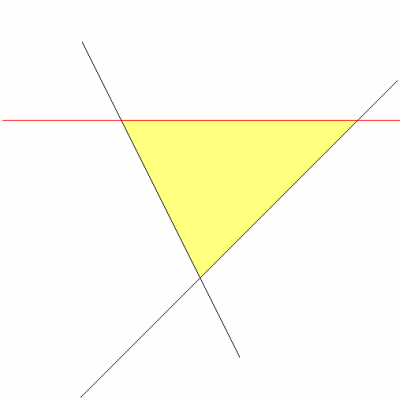
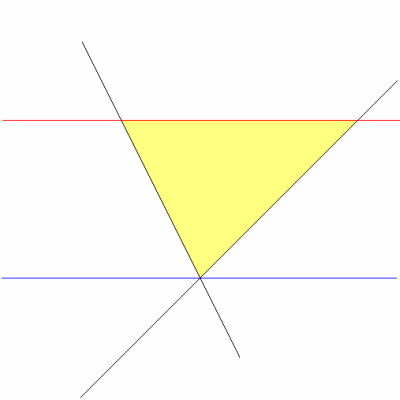
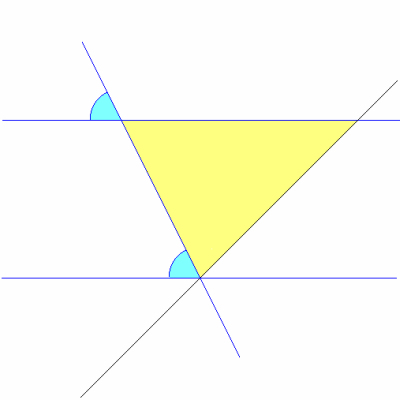
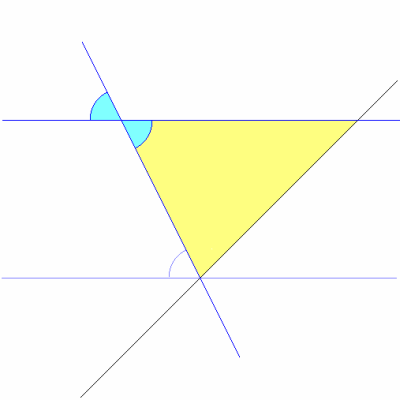
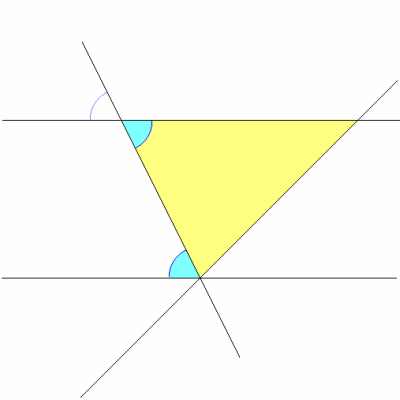
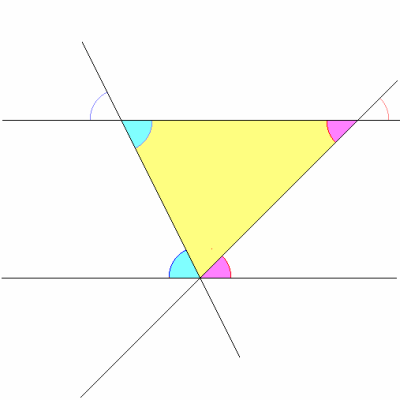
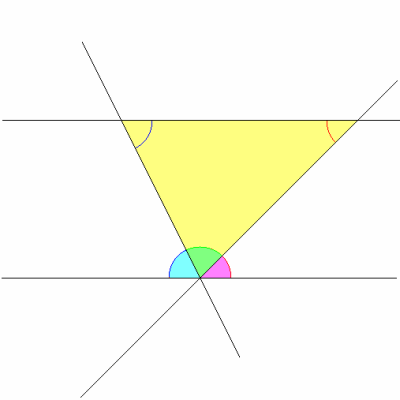
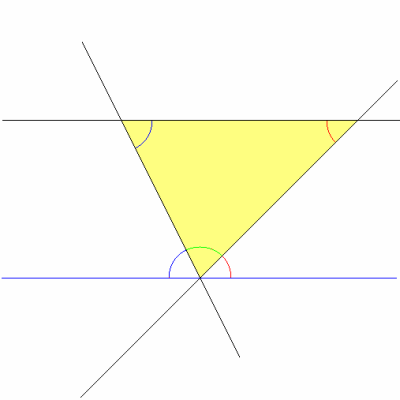 #
#